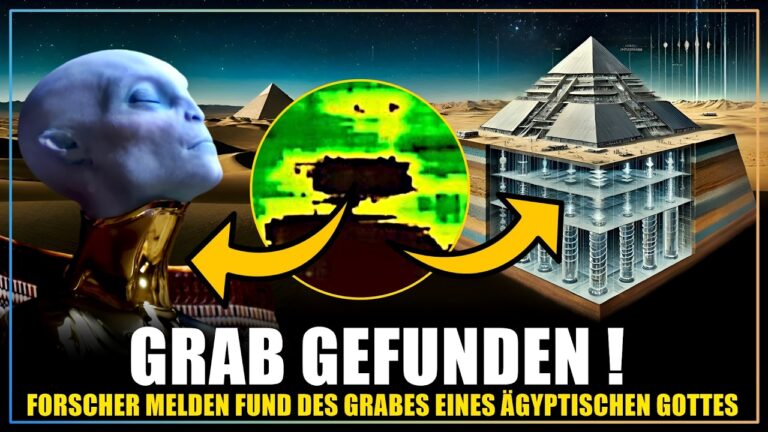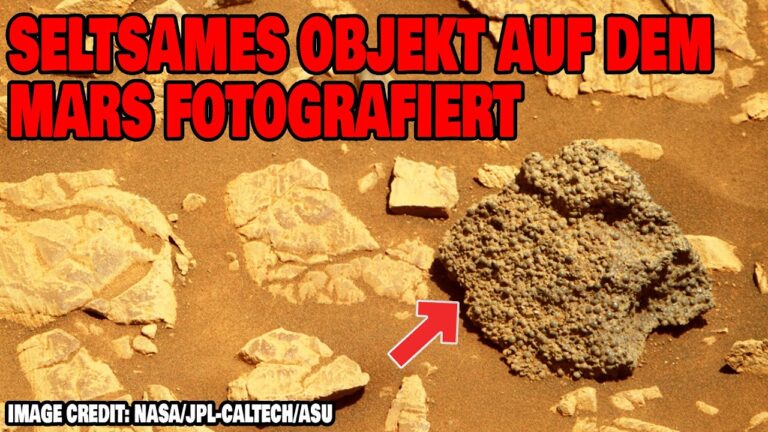Planetarien üben auf viele Menschen eine ganz besondere Faszination aus. Ob gigantische Kuppeln mit hunderten Sitzplätzen oder kleinere Schulplanetarien, in denen Schülerinnen und Schüler erstmals die Wunder des Weltalls kennenlernen: Sie alle erfüllen den gleichen Zweck, nämlich Wissen über den Kosmos auf eindrucksvolle und immersive Weise zu vermitteln. Doch wie lassen sich Planetarien eigentlich unterscheiden und in verschiedene Kategorien einteilen? Genau diese Frage sorgt in der Fachwelt für Diskussionen.
Denn derzeit gibt es keine weltweit einheitliche, allgemein akzeptierte Norm, um Planetarien eindeutig zu klassifizieren. Manche Experten orientieren sich am Kuppeldurchmesser, andere stellen die Sitzplatzkapazität in den Vordergrund. Wiederum andere Planetarier sehen in der Leistung und Bauart des Projektors den wichtigsten Faktor. Dieser Blogpost fasst die gängigsten Vorschläge zusammen und zeigt, wo ihre jeweiligen Stärken und Schwächen liegen.
Warum überhaupt eine Klassifizierung?
Bevor wir uns den konkreten Definitionen widmen, stellt sich die Frage, warum es überhaupt wichtig sein könnte, Planetarien in „Groß“, „Mittel“ oder „Klein“ einzuordnen. Zum einen bieten Klassifizierungen eine gewisse Orientierung: Wer ein Planetarium besucht oder plant, interessiert sich möglicherweise dafür, wie groß die Kuppel ist, wie viele Plätze es gibt oder welche Technik zum Einsatz kommt. Zum anderen spielt die Einteilung häufig eine Rolle bei Förderungen, Kooperationen und Vernetzungen unter Planetarien. Große Häuser haben oft ein anderes Budget und andere Möglichkeiten als kleine – und benötigen dementsprechend andere Konzepte und Standards.
Allerdings kann eine falsche oder ungenaue Klassifizierung auch zu Missverständnissen führen. Daher suchen Fachleute seit Langem nach einer klaren, allgemein verständlichen Regelung.
Die vier Definitionen im Überblick
-
Kategorisierung nach Kuppeldurchmesser (PlanetariumsClub)
Bei dieser Definition entscheidet allein die Größe der Kuppel über die Zuordnung zu einer Kategorie. So gilt:- Großplanetarium: Durchmesser D ≥ 18 m
- Mittelplanetarium: 10 m ≤ D < 18 m
- Kleinplanetarium: 5 m ≤ D < 10 m
- Schulplanetarium: D < 5 m
Vorteil: Die Kuppelgröße ist ein sehr offensichtlicher Wert. Besucher und Betreiber können sie leicht messen, wodurch eine relativ klare Einstufung möglich wird.
Nachteil: Die reine Kuppelgröße sagt nichts über die tatsächliche Sitzplatzzahl oder die Projektorqualität aus. Ein Planetarium mit 18-Meter-Kuppel könnte sehr wenige Sitzplätze haben oder veraltete Technik einsetzen, während ein etwas kleineres Haus modernste Geräte verwendet. -
Kuppeldurchmesser im „Fünf-Meter-System“ (Scholl)
Eine ähnliche Methode, aber mit anderen Grenzwerten.- Großplanetarium: D > 15 m
- Mittelplanetarium: 10 m ≤ D ≤ 15 m
- Kleinplanetarium: D < 10 m
Vorteil: Auch hier ist die Bestimmung des Kuppeldurchmessers einfach und klar.
Nachteil: Die Klassen springen ggf. abrupt. Wo liegen also die besonderen Eigenschaften, wenn ein Planetarium z. B. genau 10 Meter misst oder knapp über 15 Metern liegt? Genauso bleibt unklar, ob Sitzplatz- und Technikfaktoren nicht viel ausschlaggebender sein könnten. -
Kuppel-Platz-Definition (Zeiss)
Das Traditionsunternehmen Zeiss, seit Jahrzehnten wichtiger Hersteller für Planetariumstechnik, schlägt eine kombinierte Einteilung vor, die sowohl den Kuppeldurchmesser als auch die Zuschauerplätze berücksichtigt:- Großplanetarium: D ≥ 18 m & ~200–400 Plätze
- Mittelplanetarium: 12 m ≤ D < 18 m & ~100–200 Plätze
- Kleinplanetarium: 5 m ≤ D < 12 m & ~30–100 Plätze
- Nicht definiert: D < 5 m & < 30 Plätze
Vorteil: Hier wird immerhin versucht, die Relation zwischen physischer Größe und tatsächlicher Kapazität zu erfassen. Das entspricht in vielen Fällen der realen Nutzung besser als ein reiner Durchmesserwert.
Nachteil: Die Sitzplatzzahl ist nicht immer einheitlich (etwa bei Sonderbestuhlungen) und hängt auch von architektonischen Layouts ab. -
Definition nach Projektorleistung
Eine vollkommen andere Herangehensweise basiert auf den eingesetzten Geräten. Je nachdem, ob ein Planetarium etwa über ein modernes Digitalsystem oder einen klassischen Sternenprojektor verfügt, und wie leistungsfähig das jeweilige Modell ist, unterscheidet man:- Großplanetarium: Universarium, Cosmorama, Modelle II–VI
- Mittelplanetarium: Starmaster, Spacemaster, M 1015, RSA SN-X
- Kleinplanetarium: ZKP-X, Goto EX-3 & E-5, Spitz, Cosmodyssee
Vorteil: Die Qualität der Projektion, die Ansteuerung, mögliche Spezialeffekte und damit das Gesamterlebnis werden besonders hervorgehoben.
Nachteil: Die Bezeichnungen der Projektoren wechseln über die Jahre, neue Systeme kommen hinzu, andere werden ausgemustert. Zudem ist das für Laien oft schwer nachvollziehbar – denn wer kennt schon alle Modellreihen und Marken?
Stärken und Schwächen – und die Suche nach einer sinnvollen Lösung
Die vorgestellten Definitionen machen deutlich, wie vielfältig das Thema ist. Weder allein die Größe der Kuppel noch die Sitzplatzanzahl oder die Projektorleistung liefern ein umfassendes Bild. Eine 18 Meter große Kuppel sagt noch nichts über das Erlebnis aus, wenn das Planetarium nur mäßig ausgestattete Technik besitzt. Umgekehrt kann ein kleinerer, technisch hochgerüsteter Raum beeindruckendere Shows bieten als ein formal als „Großplanetarium“ eingestuftes Haus.
Eine mögliche Lösung könnte in einer Mehrfaktoren-Definition liegen, die sowohl Kuppeldurchmesser als auch Platzangebot und Projektorleistung vereint. Denkbar wäre ein Klassifikationssystem, das mehrere Kriterien berücksichtigt und ihnen jeweils eine bestimmte Gewichtung gibt. So ließe sich eine Art Gesamtscore ermitteln, um Planetarien objektiver einzustufen. Genau hier liegt jedoch die Krux: Welche Faktoren sind wirklich unverzichtbar, und wie gewichtet man sie sinnvoll, damit das Resultat weder zu kompliziert noch zu einseitig wird?
Fazit
Auch wenn bislang keine einheitliche, bindende Norm existiert, kann die Diskussion um unterschiedliche Einteilungen helfen, das Bewusstsein für die Vielfalt moderner Planetarien zu schärfen. Immerhin reicht die Spannbreite von privat betriebenen Kleinanlagen mit wenigen Plätzen bis hin zu gigantischen Häusern, die wie große Theater wirken und jährlich Tausende Besucher empfangen.
Ob man nun den Durchmesser als entscheidendes Merkmal betrachtet, die Anzahl der Sitzplätze einbezieht oder sich von der verfügbaren Technik leiten lässt, hängt letztlich von den konkreten Zielen und dem Kontext ab. Für Besucher dürfte die Frage nach dem „besten“ Planetarium ohnehin subjektiv geprägt sein: Entscheidend ist das Gesamterlebnis – und das kann klein, aber fein ebenso faszinierend sein wie groß und pompös.